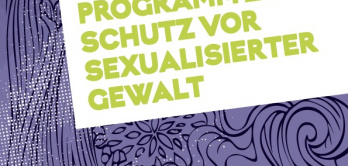Notwendigkeit eines Schutzkonzeptes für die ver.di Jugend
Sexualisierte Gewalt kann in verschiedenen Kontexten der Jugendverbandsarbeit vorkommen. Der spezielle Rahmen der Jugendarbeit kann dabei sogar als besonderer Gefährdungsraum betrachtet werden, da sich Menschen in formalisierten wie nicht-formalisierten Hierarchieverhältnissen begegnen und sich dabei in einem stark selbstreferenziellen Sozialraum befinden. Als ver.di Jugend wollen wir mit einem Schutzkonzept einen Rahmen schaffen, der ein Bewusstsein für diese besondere Gefährdungssituation schafft und gleichzeitig genaue Aktions- und Kommunikationspläne für Fälle von sexualisierter Gewalt bestimmt. Der Fokus des Schutzkonzeptes liegt damit in der Prävention sexualisierter Gewalt, andere Gewalt- und Diskriminierungsformen werden über das Schutzkonzept nicht abgedeckt. Bei sexualisierter Gewalt soll die Perspektive der Betroffenen in den Vordergrund gestellt werden. Betroffene sollen sicher sein können, dass sie ernst genommen werden, wenn sie sich aufgrund erfahrener sexualisierter Gewalt melden.
Bei Unsicherheiten hinsichtlich möglicher Unterstützungsschritte wird empfohlen, sich an eine Vertrauensperson oder an eine Person aus dem Interventionsteam zu wenden. Betroffene können sich ebenfalls an diese Personen wenden.
Als Jugendverband der Gewerkschaft ver.di organisiert die ver.di Jugend Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr. Aktiv werden Jugendliche bei uns etwa ab dem 16. Lebensjahr, wobei der überwiegende Teil unserer aktiven Mitglieder zwischen 20 und 30 Jahren alt ist. In der Jugendarbeit von ver.di findet politische Willensbildung, Bildungsarbeit, (J)AV-Arbeit, (Jugend)tarif und -kampagnenarbeit statt. Dafür organisieren wir Camps, Aktiventreffen und Seminare. Unsere demokratisch legitimierten Gremien und Konferenzen sind immer ein Ort der Gemeinschaft und der sozialen Interaktion.
Betreut werden die Aktiven von Gewerkschaftssekretär*innen im Betreuungsbereich Jugend, die sich in der Altersstruktur ungefähr im selben Bereich bewegen, mit einzelnen Abweichungen nach oben. Es gibt drei Strukturebenen innerhalb der ver.di Jugend: Die Ebene der Landesbezirke mit einer Untergliederung in Bezirke sowie die der Fachbereiche. Die Fachbereiche und Landesbezirke werden von der Bundesebene unterstützt. Diese Engagement-Ebenen sind ineinander verschränkt und viele Ehrenamtliche sind in mehreren Sphären unterwegs. In ver.di Jugend Vorständen – unabhängig von der Ebene – kommen junge Ehrenamtliche in regelmäßigen Abständen zusammen, um gemeinsam Projekte und Arbeitsvorhaben zu gestalten.
Des Weiteren organisiert die ver.di Jugend Konferenzen, Aktiventreffen und ähnliche offene Veranstaltungen. Bei diesen Veranstaltungen kommen in der Regel eher unbekannte Aktive und auch Interessierte (noch) Nicht-Mitglieder zusammen. Camps stellen hierbei eine besondere Situation dar, da teilweise in Zelten oder Bungalows übernachtet wird.
Ein weiterer Engagement-Raum in der ver.di Jugend ist die gewerkschaftliche Jugendbildungsarbeit. Hier wird im Peer-to-Peer Ansatz in Seminarkontexten Wissen vermittelt und Haltung erarbeitet.
Das Schutzkonzept gilt für ehrenamtliche Aktive, sowie hauptamtliche Kolleg*innen der ver.di Jugend und für alle Veranstaltungen der ver.di Jugend und wird im Rahmen der Arbeit der ver.di Jugend angewendet.
Das Präventions- und Aktionsprogramm der ver.di Jugend auf der Bundesebene zum Schutz vor sexualisierter Gewalt ist in der Organisation bekannt und wird den ehren- wie hauptamtlichen Kolleg*innen zur Verfügung gestellt. Alle zwei Jahre findet eine Evaluation des Konzepts im Bundesjugendvorstand statt. Dabei wird ein Jahr genutzt, um das jeweils evaluierte Schutzkonzept anzuwenden; im anderen Jahr erfolgt die Evaluation. Dazu wird jeweils eine Steuerungsgruppe gegründet. Diese Steuerungsgruppe besteht aus drei Personen aus dem Kreis der Landesjugendsekretär*innen sowie Bundesfachbereichsjugendkoordinator*innen, drei Personen aus dem Kreis der Teamenden auf Bundesebene und Personen aus dem amtierenden Bundesjugendvorstand. Die Steuerungsgruppe hat den Auftrag, die Evaluation des Schutzkonzeptes zu begleiten, und dem Bundesjugendvorstand Vorschläge zur Verbesserung zu unterbreiten. Die Gruppen, aus denen sich die Steuerungsgruppe zusammensetzt, nehmen zwischen den Evaluationen jederzeit Rückmeldungen durch Anwender*innen des Schutzkonzepts entgegen.
Notwendige Maßnahmen zur Prävention
Wie beschrieben liegt das Hauptaugenmerk des Schutzkonzeptes der ver.di Jugend auf der Prävention. Für eine gelungene Prävention muss sich in jedem Arbeitskontext mit dem Thema sexualisierte Gewalt auseinandergesetzt werden.
Daher beinhaltet das Präventionsprogramm vier Schritte:
- Verständigung auf gewaltfreies Miteinander
- kontinuierliche Schulungen / Fortbildungen
- Bilden von Interventionsteams aus mindestens zwei Personen
- Durchführung von Risiko- und Gefährdungsanalysen vor Veranstaltungen
Das Interventionsteam ist eine geschulte Gruppe innerhalb der jeweiligen Organisationseinheit der ver.di Jugend, die bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt schnell und vertraulich handelt. Sie nehmen Meldungen entgegen, schützt Betroffene und leiten notwendige Maßnahmen ein. Ziel ist es, eine sichere Umgebung zu gewährleisten und Betroffene zu unterstützen. Ab 30 Teilnehmenden soll das Interventionsteam aus mindestens drei Personen gebildet werden und kann zusätzlich zu anwesenden Teilnehmenden geplant werden. Dabei soll auf ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen den Geschlechtern sowie haupt- und ehrenamtlichen Kolleg*innen geachtet werden. Wenn keine geeignete FLINTA-Person vor Ort verfügbar ist, wird das Interventionsteam vorrangig mit Personen besetzt, die eine besondere Sensibilisierung und Schulung im Bereich sexualisierte Gewalt nachweisen können. Ziel ist es, dass alle Aktiven ehrenamtlichen schnellstmöglich geschult und sensibilisiert werden. Ergänzend kann nach entsprechender Absprache in der Organisationseinheit, das Interventionsteam in solchen Fällen eine externe FLINTA-Ansprechperson (z. B. aus einer Beratungsstelle oder einem benachbarten Verband) hinzuziehen können, um die Perspektive von FLINTA-Personen einzubinden und die Betroffenen bestmöglich zu unterstützen. Die Entscheidungen zur Teamzusammensetzung erfolgen transparent und im Sinne größtmöglicher Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit in der jeweiligen Organisationseinheit vor Ort.
Selbstverständlich kann ein bundesweites Konzept nicht die Absprachen und Verabredungen des jeweiligen Arbeitszusammenhangs ersetzen. Dafür wird empfohlen, zu Beginn jeder Legislaturperiode oder Veranstaltung gemeinsam Verabredungen zur gewaltfreien Zusammenarbeit zu treffen. Dies gilt auch bei Neukonstituierungen von Gremien.
Damit das Präventions- und Aktionsprogramm gut umgesetzt werden kann, benötigt es kontinuierliche Schulungen sowohl der hauptamtlichen Kolleg*innen wie auch ehrenamtlich Aktiven. Es braucht präventive Bildungs- und Reflexionsangebote für ehrenamtlich Aktive, hauptamtliche Kolleg*innen und teamende Personen.
Es gibt eine Grundqualifikation „How to Schutzkonzept“ um erste Unsicherheiten im Umgang mit dem Schutzkonzept abzubauen und ein Grundverständnis für die Machtverhältnisse und den Umgang hiermit zu schaffen, an der alle ehrenamtlich Aktiven und Teamenden teilnehmen sollten.
Es gibt ein extra Angebot für hauptamtliche Personen, um für bestehende Machtverhältnisse einen Austausch zu schaffen; hierbei wird der spezielle Fokus mit einbezogen, dass die Hauptamtlichkeit selbst ein Machtverhältnis ist und inwiefern hauptamtliche Personen innerhalb der Struktur privat interagieren können. Dies findet beispielsweise beim bundesweiten Jugendsekretär*innentreffen statt, wo es auch standardmäßig einen Punkt zur Prävention sexualisierter Gewalt gibt, dort kann einmal zum Thema Prävention geschult und eine kollegiale Beratung initiiert werden.
Aus dem Ehrenamt heraus, gibt es die Forderung, dass das Angebot zur Prävention sexualisierter Gewalt im internen Weiterbildungsprogramm von ver.di erhalten bleibt. Der BJV übernimmt Verantwortung für das Schutzkonzept und dessen Umsetzung und sorgt dafür, dass es einen Teamendenpool aus qualifizierten Teamenden der ver.di Jugend zu Themen rund um Sensibilisierung und das Schutzkonzept gibt und bietet eine regelmäßige Plattform für einen Austausch.
Hier können Fachbereiche, wie auch Landesbezirke über den Bereich Jugend Termine anfragen, an denen Teamende zu den anfragenden Bereichen fahren und dort Qualifizierungen durchführen.
Themen für Workshops können individuell entwickelt werden, grundlegend gibt es allerdings Angebote für:
- Rolle in meinem Hauptamt mit dem Schutzkonzept
- Wie kann Aufarbeitung mit gewaltausübenden Personen aussehen?
- Wie kann Betroffenenschutz aussehen?
- Grundqualifizierung How to Schutzkonzept (Konzept vorhanden)
- Umgang bei Vorfällen
- How to Gefährdungsanalyse?
- Was ist eigentliche Rape Culture?
- Empowerment von Betroffenen
- Rolle Interventionsteams
- Wie funktioniert herrschaftskritische Kritik?
Die Sensibilisierung zielt darauf ab, dass hauptamtliche Kolleg*innen und ehrenamtliche Aktive:
- ein Grundwissen zur Problematik sexualisierter Gewalt erhalten
- die Schutz- und Interventionsmaßnahmen der Organisation kennen
- einen Umgang mit (Verdachts-)Fällen sexualisierter Gewalt haben
- auch mit sexualisierter Gewalt im digitalen Raum umgehen können
Für die ehrenamtlichen Kolleg*innen wird angeregt, dass das Thema in Gremiensitzungen regelmäßig aufgerufen wird. Dafür bestimmt jedes Gremium selbst, in welchem Turnus, mindestens jedoch einmal im Jahr. Unterstützend können Workshops für die Gremien durchgeführt werden. Für Teamer*innen in der ver.di Jugend gilt, dass in ihrer Teamer*innen-Ausbildung das Präventions- und Aktionsprogramm der ver.di Jugend zum Schutz vor sexualisierter Gewalt besprochen und ein Augenmerk auf die besondere Risikosituation in Bildungskontexten gelegt wird. Teamer*innen zeigen alle 2 Jahre ihr erweitertes Führungszeugnis der hauptamtlich bildungsverantwortlichen Person vor. Bei vorhandenen Einträgen wird ein Gespräch zwischen Teamende*r*m sowie hauptamtlich bildungsverantwortlicher Person geführt, um mögliche Hintergründe des Eintrags zu klären. Ein weiterer Teamendeneinsatz liegt dann im Ermessen der hauptamtlich bildungsverantwortlichen Person. Bei Einträgen von Delikten gegen die sexuelle Selbstbestimmung oder Delikten gegen Minderjährige ist ein weiterer Einsatz ausgeschlossen.
Die Verantwortlichen jedes Veranstaltungsformats müssen vor der jeweiligen Veranstaltung eine Risiko- und Gefährdungsanalyse durchführen. Die Gefährdungsanalyse hat das Ziel, bereits im Vorfeld einer Veranstaltung gemeinsam mit den verantwortlichen Beteiligten klare Absprachen zu treffen. Sie sollte vor Beginn der Veranstaltung besprochen werden, um mögliche Risiken frühzeitig zu erkennen und, falls erforderlich, geeignete Schutzmaßnahmen für die Teilnehmenden zu vereinbaren. Zur Unterstützung wird eine Muster-Checkliste für die Risiko- und Gefährdungsanalyse zur Verfügung gestellt. Diese Checkliste ist an das Schutzkonzept angehangen.
Diese Risiko- und Gefährdungsanalysen sollen sowohl:
- die Teilnehmendenstrukturen analysieren und prüfen, ob minderjährige Kolleg*innen angemeldet sind
- risikoreiche Orte sowie Situationen von der Anmeldung bis zur Abreise identifizieren,
- einen Umgang mit Alkohol- bzw. Drogenkonsum besprechen
- sowie Notfallkontakte für die Situation vor Ort eruieren
- alle Beteiligten im Vorfeld auf mögliche Gefahren sensibilisieren und Absprachen treffen
- prüfen, ob weitere Konzepte zur Prävention und Intervention sexualisierter Gewalt Awareness- oder Schutzkonzepte greifen, wenn Veranstaltungen in externen Häusern oder mit anderen Organisationen stattfinden. Diese müssen im Vorfeld übereinandergelegt und im Team der Verantwortlichen geklärt werden, welche Regelungen Anwendung finden
Minderjährige Teilnehmer*innen haben einen erhöhten gesetzlichen Betreuungsanspruch, der während der gesamten Veranstaltung gewährleistet werden muss.
Wenn das Präventionsprogramm nicht ausreicht und es zu einem Vorfall kommt, greifen die Aktions-und Kommunikationspläne des nächsten Kapitels. Es ist notwendig, dass diese vor jeder Veranstaltung von den verantwortlichen Personen durchgegangen werden, um im Notfall schnell reagieren zu können. Dazu ist es auch erforderlich, dass die verantwortlichen Personen im Notfall schnell reagieren können. Das bedeutet für den Konsum von Alkohol, dass die verantwortlichen Personen zu jeder Zeit ansprechbar und nüchtern sind. Die verantwortlichen Personen werden vor der Veranstaltung im Team benannt.
Nach einem Vorfall ist es wichtig, dass dieser dokumentiert und an den Bereich Jugend weitergegeben wird. Damit soll eingeschränkt werden, dass übergriffige Personen sich nach einer Tat konsequenzlos in einer anderen Engagement-Ebene betätigen können. Dafür ist ein ehrlicher Austausch zwischen den Landesbezirken und Fachbereichen notwendig. Zu diesem Zweck wird auch ein Austausch mit den DGB Schwestergewerkschaften und der DGB-Jugend angestrebt. Die Daten der betroffenen Person werden dabei anonymisiert.
Die Kommunikation mit dem DGB und weiteren Schwestergewerkschaften erfolgt dann, wenn die übergriffige Person sich wissentlich in den befreundeten Organisationen aufhält. Die Information wird über die jeweils zuständige Ebene möglichst unter den Hauptamtlichen geteilt.
Für die Bearbeitung eines Falls kann eine Fallgruppe gebildet werden, um sich über das weitere Vorgehen, Konsequenzen, Kommunikationswege und Wording gemeinsam zu verständigen und die Verantwortung aufzuteilen, dies soll vor allem hauptamtlich geschehen, kann jedoch auch mit ehrenamtlich Aktiven erfolgen. Diese Gruppen können auch landesbezirks- und fachbereichsübergreifend gebildet werden und in enger Abstimmung Fälle gemeinsam und vertrauensvoll bearbeiten, sowie gemeinsam die Dokumentation und ggf. Evaluation der Fälle durchführen. Fallgruppen können sich an Beratungsstellen wenden um sich Unterstützung zu suchen (siehe Anhang) durch fachliche Beratung oder Supervision. Auch themenerfahrene hauptamtliche Kolleg*innen, Teamende auf Bundesebene und der BJV können als Unterstützung für die Gruppen angefragt werden.
Nach Abschluss eines Vorfalls entscheiden die Fallverantwortlichen oder Fallgruppen über die weitere Kommunikation innerhalb der Organisation zur weiteren Prävention, Transparenz bei Konsequenzen und um Gerüchten vorzubeugen. Dabei ist stets der Schutz der Betroffenen zu berücksichtigen und die Menge an Informationen so gering wie möglich zu halten.
Wir unterscheiden bei Vorfällen in drei Kategorien:
Grenzüberschreitend
- ohne Absicht
- aus Unwissenheit
- keine Wahrnehmung von Grenzen
Übergriffig
- absichtlich
- planvolles Handeln
- Missachtung von Grenzen
Nötigend
- absichtlich
- planvolles Handeln
- Missachtung von Grenzen
- Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung nach StGB (weitere Infos in interner Handreichung)
Wir können nicht ausschließen, dass auch hauptamtliche Kolleg*innen übergriffig handeln. In diesen Fällen ist es besonders wichtig, Machtverhältnisse mitzudenken und Betroffene zu stärken. Wird ein Vorfall oder eine Grenzüberschreitung durch eine hauptamtliche Person bekannt, kann die zuständige Führungskraft innerhalb von ver.di informiert werden. Darüber hinaus kann sich an weitere bekannte Bereiche von ver.di, beispielsweise beim Bereich Jugend auf Bundesebene, gewandt werden. Ehrenamtliche müssen die Möglichkeit haben, sich auch an andere Personen als die involvierte Hauptamtliche zu wenden – z. B. an Vertrauenspersonen oder Mitglieder des Interventionsteams.
Neue ehrenamtlich Aktive sind oft mit den innerorganisatorischen Abläufen und Strukturen nicht vertraut. Umso wichtiger ist es, niedrigschwellige Informationen über das Schutzkonzept, die Ansprechpersonen und mögliche Verhaltensschritte bereitzustellen. Bei der ersten Teilnahme an Veranstaltungen, Gremien oder Bildungsangeboten erhalten neue Ehrenamtliche einen Überblick über das Schutzkonzept sowie Hinweise, an wen sie sich im Problemfall wenden können – auch unabhängig von hierarchischen Zuständigkeiten. Diese Informationen sollen aktiv vermittelt werden, nicht nur passiv bereitgestellt.
Wer sexualisierte Gewalt oder grenzüberschreitendes Verhalten meldet, hat ein Recht darauf, ernst genommen zu werden – unabhängig davon, ob sie ehrenamtlich aktiv oder hauptamtliche Kolleg*innen sind. Wenn eine Meldung durch eine Person nicht aufgegriffen oder bagatellisiert wird, stellt dies selbst eine Schutzlücke dar. In solchen Fällen soll die betroffene Person ermutigt werden, sich an eine alternative Ansprechperson zu wenden. Wir appellieren an alle haupt- und ehrenamtlichen Kolleg*innen Hinweise und Meldungen verantwortungsvoll weiterzuleiten oder die Kommunikation darüber transparent zu gestalten.
Die ver.di Jugend ist sich im Klaren darüber, dass die Verbreitung von Gerüchten durch Unbeteiligte betroffene Personen verunsichern kann und so dazu führen kann, dass Vorfälle nicht gemeldet werden und somit nicht verfolgt werden können. Die Verbreitung von Gerüchten kann folglich Täter*innenschutz bedeuten und daran möchte sich die ver.di Jugend nicht beteiligen.
Die ver.di Jugend sensibilisiert ihre Mitglieder im Rahmen dieses Schutzkonzepts zu Täterstrategien und dem Umgang mit solchen. Vertiefende Informationen finden sich im Anhang und im online-BiZ.
Wir appellieren an hauptamtliche Personen bei Gerüchten zum Thema sexualisierte Gewalt verbreitende Personen anzusprechen und sie mit den Inhalten der Gerüchte zu konfrontieren. Gerüchte können Startpunkt einer Intervention und Aufarbeitung sein, weil die Verbreitung von Gerüchten durch Betroffene auch eine Art der Mitteilung sein kann.
Mögliche Konsequenzen bei Vorfällen
- Die grenzüberschreitende Person wird auf ihr Verhalten aufmerksam gemacht.
- Die grenzüberschreitende Person wird aufgefordert, ein Seminar zum Thema Prävention von sexualisierter Gewalt zu besuchen.
-
Die übergriffige Person wird auf ihr Verhalten aufmerksam gemacht.
- Die übergriffige Person wird aufgefordert ein Seminar zum Thema Prävention von sexualisierter Gewalt zu besuchen.
- Verweis von der Veranstaltung – bei Konferenzen sowie Gremien kann dies nur über die Tagungsleitung erfolgen.
- Der Entsendebereich wird nach der Information über den Vorfall aufgefordert, eine andere Person zu entsenden.
- Übergriffige Teamende werden von weiteren Teameinsätzen in ver.di ausgeschlossen.
- Bei übergriffigen hauptamtlichen Kolleg*innen wird die Führungskraft informiert.
-
Die nötigende Person wird auf ihr Verhalten aufmerksam gemacht.
- Die nötigende Person wird aufgefordert, ein Seminar zum Thema Prävention von sexualisierter Gewalt zu besuchen.
- Verweis von der Veranstaltung – bei Konferenzen sowie Gremien kann dies nur über die Tagungsleitung erfolgen.
- Der Entsendebereich wird nach der Information über den Vorfall aufgefordert, eine andere Person zu entsenden.
- Nötigende Teamende werden von weiteren Teameinsätzen in ver.di ausgeschlossen.
- Bei nötigenden hauptamtlichen Kolleg*innen wird die Führungskraft informiert.
- Begleitung des Opfers als Zeug*innen in möglichen Strafverfahren.
- Bei selbsteingeschätzter psychischer Fähigkeit der potentiellen Begleitperson und Wunsch des Opfers Begleitung zu Terminen im weiteren Verfahren (z. B. Begleitung zur Polizei / kein juristischer Beistand).
Aktions- und Kommunikationspläne bei Vorfällen
Idealtypisch wurden drei Veranstaltungsformate der ver.di Jugend zusammengefasst. Selbstverständlich muss für jede Veranstaltung noch einmal geprüft werden, in welches der drei Cluster die Veranstaltung am besten passt.
Die Cluster sind dann noch mal in vier Phasen unterteilt. Diese vier Phasen sind teilweise aber nicht zwangsläufig chronologisch. Die erste Phase beschreibt die Situation des Vorfalls und ist dann noch mal in drei Stufen unterteilt: In der Situation, berichtet mir eine betroffene Person oder eine nichtbetroffene Person.
Die zweite Phase findet nach dem Vorfall statt; hierbei geht um die Bedarfe der betroffenen Person. Dafür ist relevant, dass Gespräche mit der betroffenen Person immer unter einem Sechs-Augen-Prinzip stattfinden, damit Missverständnisse minimiert werden und Verabredungen unter Zeuginnen getroffen werden. Eine gute Dokumentation ist hier notwendig, muss jedoch vorher mit der betroffenen Person abgesprochen werden. Am besten schaut die betroffene Person am Ende des Gesprächs auf die Dokumentation und schriftlich festgehaltenen Verabredungen und zeichnet diese ab, so können Missverständnisse geklärt werden. In diesem Schritt kann auf die professionellen Unterstützungsmöglichkeiten und Notfallkontakte hingewiesen werden, um auch die Möglichkeit von juristischer Aufklärung des Tatbestandes zu prüfen. Im Nachgang zum Gespräch soll ein Angebot zu einem Nachsorgegespräch mit einer, bestenfalls, hauptamtlichen Person gemacht werden. Dieses Angebot soll auch zu einem späteren Zeitpunkt angenommen werden können, daher soll ein Austausch von Kontaktdaten an dieser Stelle erfolgen.
In der nächsten Phase wird das Gespräch mit der gewaltausübenden / beschuldigten Person gesucht. Hier ist es zwingend notwendig, dass das Gespräch mit Zeug*innen geführt und gut dokumentiert wird. Die Entscheidung über Konsequenzen für die gewaltausübende / beschuldigte Person liegt dabei bei der Person / den Personen, die für die jeweilige Veranstaltung verantwortlich sind oder an die diese Verantwortung delegiert wurde (z. B. Interventionsteam oder Fallgruppe). Die Organisation hat dabei eine Fürsorgepflicht gegenüber den anderen Teilnehmer*innen ihrer Veranstaltungen. Nachfolgend wird der Entsendebereich informiert.
In Gremiensitzungen gibt es die Besonderheit, dass die Teilnehmer*innen in der Regel demokratisch in ihr Amt gewählt wurden und eine eher konstante Teilnehmer*innenstruktur besteht. Daher müssen Gruppen- und Hierarchiedynamiken in diesem Cluster immer stark mitgedacht werden. In der Regel ist bei Gremiensitzungen eine hauptamtliche Betreuung vor Ort, die für die Umsetzung des Schutzkonzepts verantwortlich ist. Die Risiko- und Gefährdungsanalyse wird einmalig entweder mit der Geschäftsführung des Gremiums oder mit dem gesamten Gremium durchgeführt.
Bei Großveranstaltungen der ver.di Jugend ist die Teilnehmendenstruktur oft sehr heterogen. In vielen Fällen kommen die Teilnehmenden nur für diese Veranstaltung zusammen und es besteht über die Veranstaltung hinaus kein Kontakt. Insbesondere bei Camps müssen bei der Planung die besonderen Übernachtungssituationen mitgedacht werden. Die Planung und Durchführung dieser Veranstaltungen findet oft in haupt- und ehrenamtlich gemischten Teams statt. Hauptamtliche Kolleg*innen sind verantwortlich für die Umsetzung des Schutzkonzeptes vor Ort. Die Risiko- und Gefährdungsanalyse wird von einem ehren- wie hauptamtlichen Interventionsteam durchgeführt.
Cluster Camps, Konferenzen, Aktiventreffen und ähnliche Veranstaltungen
In unseren Seminar- und Bildungssituationen sind in der Regel keine hauptamtlichen Kolleg*innen in der konkreten Planung und Durchführung der Veranstaltung involviert. Das bedeutet, dass Teamende für die Umsetzung des Schutzkonzeptes im konkreten Seminarablauf verantwortlich sind. Jede Seminar- und Bildungsveranstaltung hat jedoch eine hauptamtliche Auftraggeber*in, die in die Phasen in Zusammenarbeit mit den Teamenden Verantwortung übernimmt.
Voraussetzung für eine gute Umsetzung des Schutzkonzepts ist es, dass Teamende sich durch Bildungsangebote sensibilisieren. Die besondere Situation mit vielen Teilnehmenden eine Bezugsgruppe in einem Haus zu sein und die vorherrschenden Machtstrukturen und Hierarchieebenen sind hierbei besonders zu betrachten.
Vor Beginn der Veranstaltung setzt sich das anwesende Team oder Großteam mit dem Schutzkonzept und der Gefährdungsanalyse auseinander. Dabei wird entschieden, ob in dieser Veranstaltungszeit ein besonderer Umgang damit nötig ist. Zudem werden lokale Beratungsnummern für Betroffene sexualisierter Gewalt recherchiert, die nachts in akuten Vorfällen kontaktiert werden können.
Tagsüber stehen im Rahmen der Bildungsveranstaltung Teamende als Interventionsteam zur Verfügung (nach Möglichkeit mindestens 2 Personen, vorher abgesprochen). Diese Teams können variabel sein und während der Veranstaltungszeit wechseln. Es können Seminarübergreifende Interventionsteams in gleichen Bildungszentrum gebildet werden. Nach Veranstaltungsende übernehmen die Beratungsnummern die Ansprechfunktion um die Teamenden zu entlasten.
Im Vorfeld werden weitere Personen aus der Bildungsstruktur festgelegt, die für Teilnehmende und Teamende erreichbar und ansprechbar sind, die Kontaktmöglichkeiten werden den Teilnehmenden kommuniziert.
Zu Beginn des Seminars sensibilisieren die Teamenden die Teilnehmenden für das Thema sexualisierter Gewalt. Hierbei ist es wichtig die Teilnehmenden zu ermutigen Grenzen zu setzen und diese zu kommunizieren. Zusätzlich ist es wichtig auch auf den Fall einzugehen, dass Teamende grenzüberschreitendes Verhalten zeigen können. Ziel ist es einen Raum zu schaffen, in dem Grenzüberschreitendes Verhalten in bilateralen Gesprächen mit den Teamenden oder in den rituellen Check-in-Runden des Seminars angesprochen werden können. Für den Fall, dass Teamende grenzüberschreitendes Verhalten zeigen und keine anderen Teamenden vor Ort anwesend sind, braucht es eine verantwortliche Ansprechperson, an die sich die Teilnehmenden wenden können für eine Aufarbeitung des Falls. Dies gilt es mit der entsprechenden hauptamtlichen Verantwortungsperson und der Bildungsstätte im Voraus zu besprechen.
Es braucht trotz offener Fehlerkultur klare Prozesse für Fälle, in denen Teamende das Schutzkonzept bewusst ignorieren oder unterlaufen. In solchen Situationen muss es möglich sein, Teamende von zukünftigen Veranstaltungen auszuschließen. Alle Teamenden, die mitbekommen, dass ihre Kolleg*innen sich absichtlich oder aus Ignoranz nicht mit dem Schutzkonzept in ihren Seminaren beschäftigen, sollen sich ermutigt fühlen dieses Verhalten der zuständigen bildungsverantwortlichen Person mitzuteilen oder den Bereich Jugend in Kenntnis zu setzen. Durch gezielte Schulungsangebote, wie unter dem Abschnitt „Schulungs- und Reflektions-Maßnahmen zur Prävention“ können Standards gesichert werden und auch bei Unklarheiten oder Gerüchten eine klare Grundlage schaffen.
Sexualisierte Gewalt kann ein belastendes Thema sein. Teamende innerhalb der ver.di Jugend existieren in der gleichen patriarchal geprägten Gesellschaft und kommen deshalb mit eigenen Erfahrungen in unsere Bildungsveranstaltungen. Daher kann es durch Erzählungen von Teilnehmenden und der Beschäftigung mit übergriffigen und Grenzüberschreitenden Situationen zu psychischen Belastungssituationen für Teamende kommen. Wir wollen eine Atmosphäre der Transparenz und Selbstreflektion in unseren Teamendenkreisen etablieren, in welchen Teamende offen über diese psychische Belastung reden können. Zudem sollen die zuständigen Hauptamtlichen vor finalen Entscheidungen zum Umgang mit gewaltausübenden Personen auf Bildungsveranstaltungen beratend hinzugezogen werden. Die zuständigen Bildungsträger vertrauen hierbei zunächst auf die Einschätzung der Teamenden Personen und geben vorrangig Unterstützung in der Entscheidung zur Umsetzung. Zusätzlich steht (aktuell) der betriebsärztliche Dienst der ver.di für Gespräche für Teamende zur Verfügung, falls diese merken, dass sie gerade eine professionelle Ansprechperson benötigen. Die Kontaktdaten bekommen Teamende von ihren zuständigen hauptamtlichen Kolleg*innen.
Innerhalb von TAK Strukturen wird die Möglichkeit einer kollegialen Beratung (im Online BiZ) / Intervision eingerichtet. Außerdem können extern Supervisionsmaßnahmen geprüft und eingerichtet werden. Hier ist besonders darauf zu achten, dass das Ziel nur ein sensibilisierter Umgang mit Situationen der sexualisierten Gewalt ist. Spekulationen zu gewaltausübenden Personen sollten vermieden werden.
Die Begleitung von Vorfällen sexualisierter Gewalt ist mit einem hohen emotionalen Aufwand verbunden. Umso wichtiger ist es, im Anschluss eine strukturierte Aufarbeitung durchzuführen. Diese dient nicht nur der Reflexion des Geschehenen, sondern vor allem der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Stärkung unseres Schutzkonzepts.
Dabei ist uns eine konstruktive und transparente Zusammenarbeit aller beteiligten Bereiche besonders wichtig. Die Einsetzung einer Aufarbeitungsgruppe liegt in der Verantwortung der hauptverantwortlichen betreuenden Person des jeweiligen Falls.
Als Unterstützung für die Aufarbeitung finden sich im Anhang beispielhafte Reflexionsfragen, die fortlaufend ergänzt und weiterentwickelt werden.
Auch Fallbearbeiter*innen, Interventionsteams und Fallgruppen können im Nachgang ihre Arbeit reflektieren und den Fall für sich verarbeiten und abschließen.
Für Vorfälle im Seminarkontext kann unter der Voraussetzung der Anonymisierung nach Absprache mit den Verantwortlichen, auch der Teamenden-Arbeitskreis genutzt werden für Intervisionen und Beratung. Es können sich außerdem kollegiale Fallberatungs- und Intervisionsgruppen zusammenfinden für Personen, die häufig Aufgaben des Schutzkonzepts übernehmen und regelmäßigen Austauschbedarf haben.
Bei psychischer Belastung können die Beratungsangebote von bundesweiten Beratungsstellen (siehe Anhang) hilfreich sein.
Die aus der Aufarbeitung entstandenen Erkenntnisse sollten für die stetige Verbesserung des Schutzkonzeptes anonymisiert an die Bundesebene weitergegeben werden.
In der Praxis kann es auch zu Fehlern kommen – das muss eingeplant werden. Eine offene Fehlerkultur ist daher essentiell: Fehler dürfen benannt und reflektiert werden, ohne dass Teamende und handelnde Akteur*innen Angst vor Konsequenzen haben müssen, wenn sie verantwortungsvoll gehandelt haben.
Falschbeschuldigungen im Kontext sexualisierter Gewalt sind äußerst selten. Untersuchungen zeigen, dass der Anteil an nachweislich falschen Vorwürfen im unteren einstelligen Prozentbereich der überhaupt gemeldeten Fälle liegt. Hinzu kommt, dass die meisten Fälle sexualisierter Gewalt nicht einmal gemeldet werden.
Wir sind uns dennoch bewusst, dass solche Situationen nicht komplett ausgeschlossen sind. Deshalb wurde ein Konzept entwickelt, das im Fall einer nachweisbaren Falschbeschuldigung zum Einsatz kommen kann. Dieses Konzept ist im internen Bereich jederzeit zugänglich und beinhaltet mehrere Schritte zur Aufarbeitung und zum Umgang mit den zu Unrecht Beschuldigten, ggf. Gremien und den Personen, die Anschuldigungen erhoben haben. So wollen wir sicherstellen, dass sowohl Betroffene als auch die Organisation geschützt und fair behandelt werden, ohne die Realität und Häufigkeit von Falschbeschuldigungen zu überschätzen.
Es ist zwingend notwendig, dass vor jeder Großveranstaltung die Kontaktmöglichkeiten der lokalen Beratungsangebote herausgesucht und für die Veranstaltung notiert werden. Generell kann sich bei sexualisierter Gewalt an Frauen an das bundesweite Hilfetelefon gewendet werden: 08000 116 016. Dieser Service steht rund um die Uhr zur Verfügung und kann auch von Personen genutzt werden, die nicht selbst betroffen sind. Bei Übergriffen gegen Männer kann diese Telefonnummer genutzt werden: 0800 1239900 (Servicezeiten: Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 20:00 Uhr und Freitag von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr).
Darüber hinaus muss den Teilnehmer*innen der Veranstaltung Kontaktmöglichkeiten der für das Präventions- und Aktionsprogramm Verantwortlichen zur Verfügung stehen. Die Kommunikationsketten müssen auch im Bildungskontext ohne hauptamtlich aktive Person vor Ort besprochen sein.
Falls sich betroffene Personen erst nach einer Veranstaltung an eine verantwortliche Person melden möchte, ist es notwendig, dass die Kontaktdaten der hauptamtlichen Kolleg*innen bekannt gemacht werden. Hier ist es auch sinnvoll mehrere Kontaktdaten aus den Jugendteams zu kommunizieren, falls eine Person sich eher nicht an die / den betreuenden Jugendsekretär*in wenden möchte. Wichtig ist, dass die Beschwerden ernst genommen werden. Das bedeutet, dass sie aufgegriffen und diskutiert sowie transparent weiterverarbeitet werden.
Als generelle Anlaufstelle für haupt- und ehrenamtliche Kolleg*innen zum Themenbereich sexualisierte Gewalt ist der Bereich Jugend auf Bundesebene vorgesehen.
Rike Müller
rike.mueller@verdi.de
030 69562355
Beschluss der ver.di Jugend auf der Sitzung des Bundesjugendvorstands am 22.04.2023
Wenn sich eine gewaltausübende / beschuldigte Person im Falle eines (nicht aufklärbaren) Falls, während ihrer Zeit in der ver.di Jugend, rehabilitieren möchte, ist zunächst zu prüfen, ob die notwendigen Indikatoren für eine Rehabilitation gegeben sind. Diese sind sehr individuell und die Entscheidung ist einzelfallabhängig. Auch wenn im folgenden grundlegende Punkte festgehalten sind, wird die finale Entscheidung durch die Fallgruppe getroffen.
Betroffenenschutz vor Rehabilitation
Bevor eine Rehabilitation stattfinden kann, muss sich die Fallgruppe darüber bewusst werden, dass der Betroffenenschutz gewährleistet ist.
Rolle der gewaltausübender / beschuldigter Person
Ob eine Rehabilitation überhaupt in Frage kommt, ist abhängig von der Rolle, die die gewaltausübender / beschuldigter Person während des Vorfalls inne hatte. Die ver.di Jugend möchte jungen Menschen auch im Falle eines Fehlverhaltens grundsätzlich die Chance geben, sich reflektieren und rehabilitieren zu können. Das Maß des Machtmissbrauchs während des Vorfalls muss in die Entscheidung mit einfließen.
Arbeitsbereitschaft der gewaltausübender / beschuldigter Person
Die Intention zur Rehabilitation muss von der gewaltausübender / beschuldigter Person kommen. Dabei ist das Maß an Reflexions- und Arbeitsbereitschaft entscheidend.
Art des Vorfalls
Eine Rehabilitation von gewaltausübender / beschuldigter Person ist in der Regel nur im Falle von Grenzüberschreitungen möglich.
Hat sich die Fallgruppe für die Rehabilitationsmöglichkeit entschieden, sind die folgenden Schritte zu befolgen:
- Auftaktgespräch mit tatausübenden bzw. vermeintlich tatausübenden Person
Die Rehabilitation wird zwischen zuständigen Gewerkschaftssekretär*in, ggf. Aktiven der Organisationeinheit und gewaltausübender / beschuldigter Person besprochen. Zuständig meint dabei zuständig für Rehabilitation bzw. im Rahmen der Aufarbeitung des Falls. Es wird ein konkreter Zeitplan erstellt und verbindliche Absprachen getroffen. Dabei ist zu klären, welche anderen Gruppen / Gremien sind betroffen. - Auftaktgespräch mit betroffenen Einzelpersonen, Gruppen / Gremien
Es ist laufend zu prüfen, ob der Grundsatz Betroffenenschutz vor Rehabilitation erfüllt ist. - ggf. Rücksprache mit weiteren haupt- und ehrenamtlichen Strukturen
- Nachhalten und Punkten der Absprachen
In regelmäßigen Terminen, welche im Zeitplan festgehalten wurden, soll der Prozess reflektiert und bewertet werden, dabei ist zu überprüfen, ob der Zeitplan eingehalten wird und die Absprachen eingehalten werden. - Auswertung und ggf. Rückkehr zum „Normal“
Am Ende des Zeitplans steht eine Auswertung. Ist die Rehabilitation entsprechend des vereinbarten Zeitplans gelaufen und wurden alle Absprachen erfüllt, kehren wir zurück zum „Normal“ und die gewaltausübender / beschuldigter Person hat keine Einschränkungen mehr das Ehrenamt bzw. die Aktivität in ver.di betreffend.
Ergänzende Hinweise
Unterstützungsangebote
Vor und während der Rehabilitation müssen Angebote geschaffen bzw. vermittelt werden, um die gewaltausübender / beschuldigter Person zu unterstützen. Mögliche Unterstützungsangebote und Anlaufstellen befinden sich im Anhang und werden regelmäßig angepasst. Angebote müssen an den Stand der Sensibilierung der gewaltausübender / beschuldigter Person angemessen ausgewählt werden.
Rolle des Hauptamts
Beteiligte hauptamtliche Personen sind als Prozessbegleiter anzusehen und geben einen Rahmen. Sie ersetzen zu keiner Zeit psychologische Betreuung.
Notfallkontakte
Es ist zwingend notwendig, dass vor jeder Großveranstaltung die Kontaktmöglichkeiten der lokalen Beratungsangebote herausgesucht und für die Veranstaltung notiert werden. Die Liste von Kontakten im Anhang zum Konzept muss um regionale Anbieter*innen ergänzt und nach Erfahrungswerten regelmäßig angepasst werden. Diese Kontakte sind nicht nur für Betroffene, sondern auch für die Fallgruppe zu benutzen. Generell kann sich bei sexualisierter Gewalt an Frauen an das bundesweite Hilfetelefon gewendet werden: 08000 116 016. Dieser Service steht rund um die Uhr zur Verfügung und kann auch von Personen genutzt werden, die nicht selbst betroffen sind.
Telefonnummer bei Übergriffen gegen Männer: 0800 1239900
Servicezeiten: Montag bis Donnerstag von 8 – 20 Uhr und Freitag 8 – 15 Uhr
Telefonnummern Telefonseelsorge: 0800 1110111 oder 0800 1110222 oder 116123
In manchen Fällen sexualisierter Gewalt müssen sich Betroffene mit dem Thema Spurensicherung auseinandersetzen. Für Betroffene ist es oft schwierig, sich sofort für eine Anzeige zu entscheiden. Die Anonyme Spurensicherung (ASS) bietet die Möglichkeit, Beweise gerichtsverwertbar sichern zu lassen, ohne direkt eine Anzeige erstatten zu müssen. Dies gibt Betroffenen Zeit, in Ruhe über das weitere Vorgehen zu entscheiden, und bewahrt gleichzeitig die Option einer späteren Strafverfolgung. Im akuten Fall ist es wichtig sich über die genauen Regelungen in den Kliniken / Stellen / Institute und Bundesländern zu informieren. Im Anhang ist das Vorgehen und Anlaufstellen zur anonymen Spurensicherung aufgeführt.
Darüber hinaus muss den Teilnehmer*innen der Veranstaltung Kontaktmöglichkeiten der für das Präventions- und Aktionsprogramm Verantwortlichen zur Verfügung stehen. Die Kommunikationsketten müssen auch im Bildungskontext ohne hauptamtliche Person vor Ort besprochen sein. Falls sich betroffene Personen erst nach einer Veranstaltung an eine verantwortliche Person melden möchte, ist es notwendig, dass die Kontaktdaten der hauptamtlichen Kolleg*innen bekannt gemacht werden. Hier ist es auch sinnvoll mehrere Kontaktdaten aus den Jugendteams zu kommunizieren, falls eine Person sich eher nicht an die / den betreuenden Jugendsekretär*in wenden möchte. Wichtig ist, dass die Beschwerden ernst genommen werden. Das bedeutet, dass sie aufgegriffen und diskutiert sowie transparent weiterverarbeitet werden. Als generelle Anlaufstelle für haupt- und ehrenamtliche Kolleg*innen zum Themenbereich sexualisierte Gewalt ist der Bereich Jugend auf Bundesebene vorgesehen.
Fragen zum Schutzkonzept können an den Bereich Jugend gestellt werden: jugend@verdi.de
Ansprechpersonen in den Landesbezirken und Bundesfachbereichen für die Meldung von Vorfällen oder Fragen zur Umsetzung vor Ort finden sich im Anhang. Beschluss der ver.di Jugend auf der Sitzung des Bundesjugendvorstands am 13.9.2025.